Das Netzwerk Erzählcafé und Migros-Engagement bieten im Rahmen der #Freundschaftsinitiative eine Reihe von Erzählcafés zum Thema «Freundschaft» an. Natalie Freitag, die das Netzwerk Erzählcafé in der Deutschschweiz koordiniert, hat mit Silvia Hablützel gesprochen. Die erfahrene Moderatorin aus Appenzell Ausserrhoden erzählt, was ihr persönlich Freundschaft bedeutet.
Interview: Natalie Freitag
Foto: zVg
Natalie Freitag: Silvia, was bedeutet Freundschaft für dich? Wie wichtig ist dir Freundschaft?
Silvia Hablützel, Fachfrau Pflege und Gesundheit und Moderatorin aus Herisau: Sie ist mir sehr wichtig. Menschen sind mir sehr wichtig. Begegnungen, Austausch haben, zusammen durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen. «Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen»: Dieses Zitat von Guy de Maupassant sagt für mich sehr viel aus.
Hast du eine langjährige Freundschaft? Oder eine ganz neue? Wie und wo kam es zu diesen Freundschaften?
Es gibt alte Freundschaften, die zu einer bestimmten Zeit des Lebens für mich sehr wichtig und intensiv waren, zum Bespiel aus der Zeit der Ausbildung, als wir zusammen Visionen und Träume teilten. Ich habe aus dieser Zeit drei Freunde*innen, die mich durchs Leben begleitet haben. Durch sie habe ich auch meinen Mann kennengelernt, als wir gemeinsam Trauzeug*innen waren an der Hochzeit einer dieser Freundinnen. Mit alten Freunden verbinden mich Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen. Das schweisst zusammen. Es gibt aber auch neue Freundschaften in meinem Leben – das Neue, einander kennenlernen und entdecken können, das ist spannend. Es gibt auch Freundinnen, die ich lange Zeit nicht sehe und keinen Kontakt habe, dennoch bleibt die emotionale Verbindung gegenseitig bestehen und wir wissen, dass wir jederzeit füreinander da sind.
Gab es auch Freundschaften, die mit der Zeit auseinandergingen?
Das gab es auch. Eine Freundschaft endete abrupt, von viel Kontakt zum totalen Kontaktabbruch. Schmerzliche Erfahrungen und Trennungen gehören eben auch zum Thema Freundschaften.
Bist du eine gute Freundin? Was tust du dafür?
Ja, das würde ich sagen. Ich habe ein offenes Ohr, habe Zeit, bin da. Zuhören, laut denken und eine Sparring-Partnerin sein, die auch kritisch ist – im Sinne eines Angebots, Beständigkeit, Vertrauen und Pflege der Beziehung durch Zeichen geben, z.B. Briefe schreiben. Und was mir ganz wichtig ist, zusammen zu lachen.
Erzähl uns noch etwas über dich und deine Arbeit mit dem Erzählcafé!
Seit vier Jahren führe ich in Herisau, Heiden und Stein im Kanton Appenzell Ausserrhoden Erzählcafés durch. Dies im Rahmen meiner Anstellung bei Pro Senectute. Erzählcafés bieten die Möglichkeit, einen Teil meines Auftrags für die Gesundheitsförderung im Alter zu erfüllen. Austausch und Gemeinschaft zu ermöglichen, gegen die Einsamkeit. Es entstehen daraus Begegnungen, manchmal Freundschaften. Man kennt sich im Dorf, wenn man sich trifft, geht zusammen auch Kaffee trinken. Was mir ganz besonders gefällt, ist die Tiefe, die Intensität, die im Erzählcafé möglich wird. Man kommt jemandem in nur ein bis zwei Stunden nahe und teilt sehr Persönliches.
Was ist deine Geschichte, die dir spontan in den Sinn kommt zum Thema Freundschaft?
Das ist eine schöne Geschichte: Es war an einem Erzählcafé zum Thema «auf den Hund gekommen». Eine Frau hatte ihre Nachbarin spontan mitgenommen, da ihr Hund gerade an diesem Morgen eingeschläfert werden musste. Es war auch ein Mann anwesend, dem Hunde sehr wichtig waren. Die beiden lernten sich dort kennen und sind heute ein Paar. Jetzt haben sie sich gerade zusammen einen jungen Hund zugelegt.
Zur Person
 Silvia Hablützel ist erfahrene Erzählcafé-Moderatorin. Sie ist Pflegefachfrau HF/BScN und Leiterin des kantonalen Programms «Zwäg is Alter» bei Pro Senectute AR. Suchen Sie eine Moderation für Ihr Erzählcafé? Hier finden Sie Kontakte.
Silvia Hablützel ist erfahrene Erzählcafé-Moderatorin. Sie ist Pflegefachfrau HF/BScN und Leiterin des kantonalen Programms «Zwäg is Alter» bei Pro Senectute AR. Suchen Sie eine Moderation für Ihr Erzählcafé? Hier finden Sie Kontakte.

 Silvia Hablützel ist erfahrene Erzählcafé-Moderatorin. Sie ist Pflegefachfrau HF/BScN und Leiterin des kantonalen Programms «Zwäg is Alter» bei Pro Senectute AR. Suchen Sie eine Moderation für Ihr Erzählcafé?
Silvia Hablützel ist erfahrene Erzählcafé-Moderatorin. Sie ist Pflegefachfrau HF/BScN und Leiterin des kantonalen Programms «Zwäg is Alter» bei Pro Senectute AR. Suchen Sie eine Moderation für Ihr Erzählcafé? 


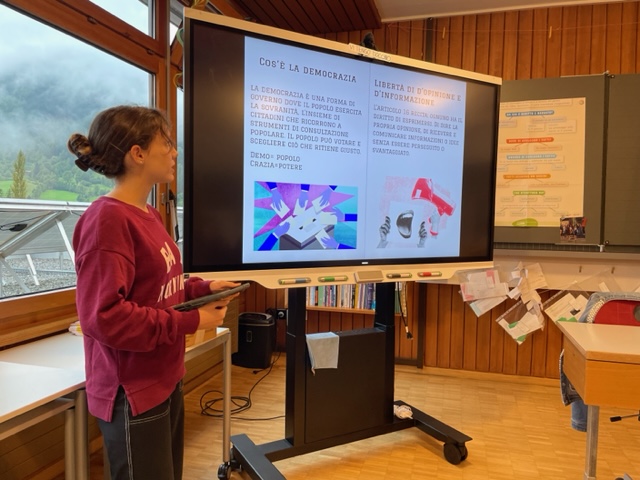
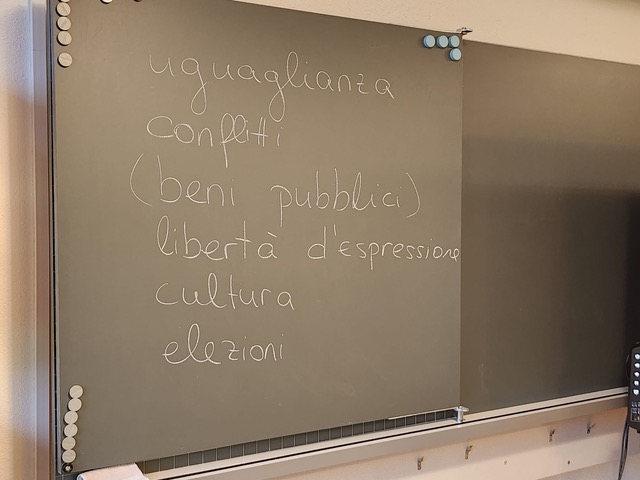
 Zur Autorin
Zur Autorin